Ilija Trojanow hat mit „Macht und Widerstand“ laut eigenen Aussagen, sein Opus magnum veröffentlicht. Er wurde 1965 in Sofia geboren und flüchtete mit seinen Eltern 1971 über Jugoslawien und Italien nach Deutschland. Er lebte unter anderem in Nairobi, Kenia, Indien und studierte in München. Ein Weltbürger – ein Weltensammler, gleich seinem sehr lesenswerten Roman.
Er schreibt neben seinen Reiseberichten Romane, zuletzt den tollen Roman „EisTau“. Jedenfalls steht auf dem neuen Buch auf dem Umschlag erneut Roman. Es ist ein Roman, aber auch ein Zeitzeugnis, ein politisches Erinnerungswerk. Denn der vorliegende Text wird mit tatsächlichen Dokumenten belegt, d.h. vertieft.
Trojanow recherchierte und erkundete 15 Jahre lang die Geschichte seiner Herkunft und die von Bulgarien. Sein Dokumentarfilm: „Vorwärts und nie vergessen! Ballade über bulgarische Helden“ (Quelle: ZDF und YouTube) ist eine Auseinandersetzung mit 45 Jahren kommunistischer Diktatur. Seine Helden sind ehemalige Häftlinge. Er begleitet diese zu ihren ehemaligen Kerkern und lässt sie von ihren Leiden und Folterungen erzählen.
Dieser Film ist das Fundament des Romans „Macht und Widerstand“, denn wenn man die Gespräche im Film sieht, findet man vieles im Roman wieder.
Der Roman erzählt die erschütternde Geschichte von Konstantin, der sein Leben lang Widerstand leistet und von dem zynischen und korrupten Metodi, der es als Karrierist bis in die obersten Ränge der Macht schafft.
Trojanow lässt beide abwechselnd ihren Weg ab den 50er-Jahren erzählen. Konstantin wurde als Jugendlicher als Anarchist und Antikommunist verurteilt. Er verbringt viele Jahre in Haft. Metodi, ein Kommunist der ersten Stunde, und Konstantin sind zwei Kontrahenten, die sich seit ihrer Kindheit immer wieder über den Weg laufen.
Bei der Suche nach demjenigen, der ihn verraten haben könnte, stößt Konstantin auf Metodi. Seine akribische und hartnäckige Recherche ruft Erinnerungen an seine Verhöre und Folterungen wach – auch an jene aus seinem engen Umkreis. In ihm ist eine Wut auf die alten Politiker und Machthaber, die auch nach 1989 einfach weiter machen konnten.
Metodi verkörpert diese Laufbahn und erzählt rückblickend seine Geschichte, die durch Brutalität, Arglosigkeit und Verachtung gefärbt ist. Seine persönliche Situation gerät durch das Auftreten von Nezabrawka ins Wanken. Sie behauptet seine Tochter zu sein. Metodi habe ihre Mutter im Arbeitslager vergewaltigt…
Der Roman liest sich spannend und schließt viele Bildungslücken. Einige Figuren bleiben etwas blaß, aber gerade dadurch bekommen die wichtigen Charaktere eine Tiefe, um das ganze Ausmaß ihrer Geschichte zu verdeutlichen.
Ein sprachlich gewaltiger Roman, der zwischen wörtlich wiedergegebenen Stasi-Akten und erfundenen Passagen wechselt. Teilweise klingt satirischer Humor durch und beizeiten wird Trojanow sogar sarkastisch. Er zitiert Dokumente und entwirft in kurzen Kapiteln ein ganzes Panorama zwischen den Jahren 1950 und 2000. Die Jahreszeiten sind es selber, die er anhand der Kapitelüberschriften erzählen lässt („1999 erzählt“ etc.). Die untergegliederten Kapitel sind jeweils nach den Ich-Erzähler-Stimmen von Konstantin oder Metodi benannt.
Ein wichtiger Roman, der es bereits auf die Longlist zum Deutschen Buchpreis geschafft hat.
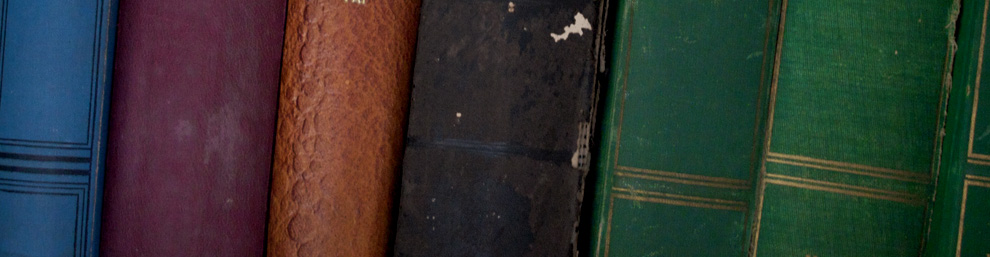

Pingback: Juan Gabriel Vásquez: „Die Gestalt der Ruinen“ | leseschatz